„Aus der Geschichte heraus Optionen für eine friedliche Zukunft entwickeln“

Heute jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zum zweiten Mal. Seit 730 Tagen leben die Ukrainer*innen mit Bomben, Zerstörung, Flucht, Tod und Trauer. Wie geht es ihnen damit? Was macht ihnen Hoffnung? Das haben wir Angela Beljak gefragt. Sie ist ukrainische Projektpartnerin für #StolenMemory, führt im Rahmen eines Dokumentationsprojekts Interviews mit Geflüchteten in Deutschland, studiert Sozialpsychologie in Kyiv, war dort lange Jahre Koordinatorin von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und weiß welche Folgen Kriegstraumata haben.
Frau Beljak, zwei Jahre Angriffskrieg, wie sieht das Leben derzeit in der Ukraine aus?
Angela Beljak: Einerseits läuft hier bei uns in Kyiv das Leben mittlerweile ganz normal weiter. Alle Geschäfte sind auf. Wir können alle Lebensmittel einkaufen. Der öffentliche Verkehr funktioniert. Die Kinder gehen in die Schule, die Menschen zur Arbeit. Andererseits ist der Krieg immer präsent. Jeden Tag gibt es Luftalarme. Dadurch haben sich neue Routinen entwickelt. Egal, wo man ist, man muss sich erst einmal erkundigen, wo der nächste Bunker oder Schutzplatz ist.

» Es geht so vielen Menschen gerade gar nicht gut, aber wir können uns gegenseitig unterstützen. «
Angela Beljak
Wie geht es Ihnen persönlich damit?
Es geht mir okay, in dem Sinne, dass wir noch am Leben sind. Unsere Wohnung, das Haus steht noch. Physisch wurden wir zum Glück verschont. Psychisch setzt einem alles, was hier passiert, sehr zu, es ist sehr schwer zu ertragen. Man muss aber stark bleiben, für die Kinder. Meine Kinder schauen auf mich und ich muss ihnen zeigen, was wir tun können, um an dieser schrecklichen Situation nicht zu verzweifeln.
Flucht nach Rumänien und Rückkehr
Zu Beginn des Krieges sind Sie mit Ihrer Familie nach Rumänien geflüchtet, haben sich dann aber entschieden, zurückzukehren, warum?
Am Anfang war nicht klar, was passieren würde. Die Bomben fielen. Es war keine Zeit zu überlegen, ob man bleiben kann oder nicht. Ich musste meine Kinder retten. Es gab keine Alternative als zu fliehen. Es war wirklich keine Ausreise, das war Flucht. Wir standen über zwölf Stunden an der Grenze, weil so viele Leute auf einmal das Land verlassen wollten. Aber nicht alle konnten fliehen. Zurück blieben viele Hilfsbedürftige, ältere Menschen. Uns ist dann klar geworden, dass diese Menschen unsere Unterstützung brauchen. Das war der Grund, warum wir zurückgekehrt sind, wir wollten physisch und psychisch unterstützen. Ich habe versucht, Hilfsprojekte in der Ukraine zu organisieren, auch in meiner Zeit in Rumänien. Wenn man diese Unterstützung geben kann, dann ist das auch eine Strategie, um selbst mental gesund zu bleiben. Es ist ein Instrument, eine Strategie fürs Überleben: Etwas für andere tun, den Zusammenhalt spüren. Du gibst viel und bekommst auch ganz viel zurück. Sich austauschen über Unsicherheiten, über Ängste, die Trauer über den verlorenen Alltag, auch das ist gerade sehr wichtig. Es geht so vielen Menschen gerade gar nicht gut, aber wir können uns gegenseitig unterstützen. Das hilft und allen. Es ist auch eine Form des Widerstandes.

Vor allem für Kinder und Jugendliche ist es schwer zu verstehen, warum ganze Dörfer in Schutt und Asche liegen wie hier in Nowoseliwka, Ukraine. (Foto: Ales Uscinaw/Pexels)
Wie geht es den Ukrainer*innen, die geflüchtet sind und noch nicht zurückkehren konnten? Was hören Sie heraus, aus den Interviews, die Sie für das Dokumentationsprojekt der Fernuni Hagen führen?
Für sie ist der Krieg genauso präsent. Die meisten haben Ehemänner, Väter, Brüder oder andere Familienangehörige oder Freunde direkt an der Front. Physisch sind sie an einem sicheren Ort, aber mental sind sie in der Ukraine. Sie schauen die Nachrichten, halten persönlichen Kontakt, sie sammeln ständig Spenden, kaufen Drohnen, engagieren sich für die Ukraine. Sie fühlen sich dem Land sehr verbunden. Allerdings ändert sich die Situation gerade. Viele, die ich in Hagen interviewt habe, stammen aus den östlichen Gebieten. Bei ihnen schwindet die Hoffnung auf einer Rückkehr. Viele werden kein Zuhause mehr haben. Gerade junge Frauen mit Kindern, die jetzt eingeschult worden, stellen sich nun auf ein dauerhaftes Leben in Deutschland ein, auch wie die Schulsysteme so unterschiedlich sind.
Ihre Arbeit als Koordinatorin von Projekten der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in der Ukraine und Belarus ruht derzeit…
Ja, die Arbeit muss leider pausieren. Ich habe mich deshalb entschieden, mich neu zu orientieren und ein Masterstudium der Sozialpsychologie zu absolvieren. Ich studiere, wie Menschen in welchem sozialen Kontext miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und wie sie, in welchen Situationen welche Entscheidungen treffen. Das ergänzt sich gut mit meiner bisherigen Arbeit und mit dem Dokumentationsprojekt in Hagen.
Sie haben zuvor Freiwilligenprogramme und Begegnungen organisiert, bei denen sich die Teilnehmenden vor allem mit den Verbrechen des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Sie selbst kennen dadurch viele ukrainische Holocaust-Überlebende. Wie erleben diese den aktuellen Krieg?
Traumata kommen wieder. Die Angst vor der Bombardierung, die Kindheitserinnerungen an den schlimmen Hunger, die Angst vor den Flugzeugen, all das kommt hoch. Viele haben die Erlebnisse von damals nie aufgearbeitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg durfte darüber nicht gesprochen werden, über Zwangsarbeit, Kriegsgefangenschaft, Konzentrationslager. Das hinterließ tiefe Wunden, die jetzt wieder aufreißen. Das zeigt, wie wichtig es jetzt ist, über Emotionen, über Ängste zu sprechen. Anders als damals gibt es viele Angebote von Psychologinnen und Psychologen. Man kann sich online zu Gesprächskreisen anmelden, auch internationale Initiativen bieten Projekte.
Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt Parallelen
Hilft es jüngeren Menschen, mit älteren über ihre Kriegserfahrung zu sprechen?
Ja, junge Menschen haben jetzt großes Interesse daran, von den Überlebensstrategien von NS-Verfolgten zu erfahren. Viele Überlebende sagen, dass es wichtig ist, sich auf den Alltag zu konzentrieren, ihn aktiv zu gestalten, mit Banalitäten wie Wasser holen, Wohnung heizen, all das hat ihnen damals geholfen, die schreckliche Zeit auch emotional zu überstehen. Viele junge Menschen suchen in der Geschichte auch Antworten auf die Frage, warum wir angegriffen wurden, warum uns so viele Russen töten wollen. Wir haben ihnen doch nichts getan. Das, was wir jetzt erleben, ist mit der Geschichte, mit dem, was in der NS-Zeit, im Zweiten Weltkrieg, passiert ist, eng verbunden. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt Parallelen: Der Vernichtungskrieg, das Konzept der Konzentrationslager, Methoden wie Menschen erschossen werden.
Mit #StolenMemory versuchen die Arolsen Archives, persönliche Gegenstände von NS-Verfolgten auch an Hinterbliebene in der Ukraine zurückzugeben. 60 so genannte Effekten aus der Ukraine sind in Bad Arolsen verwahrt. Haben die Menschen vor Ort derzeit für so etwas überhaupt einen Kopf?
Wenn Familienangehörige im Krieg verschwinden, überschattet das als traumatische Erfahrung ganze Generationen. Wenn man nicht weiß, was mit einem Menschen passiert ist, dem lieben Menschen, diesem wichtigen Teil von mir und meiner Familie, meiner Vergangenheit. Zurückkehrende Gegenstände, Erinnerungsstücke können solche Lücken schließen. Es sind Symbole, ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch jetzt wieder einen Platz in der Familie gefunden hat. Solche Lücken reißt auch der aktuelle Krieg. Man hört lange Zeit nichts von Soldaten oder auch Zivilisten, man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Es ist unglaublich schwer, so etwas zu verstehen und zu ertragen. Deshalb ist dieses Projekt so wichtig und ich finde es gut, dass die Begleitausstellung nun in ukrainischer Sprache durch Polen tourt und an Orten gastiert, in denen viele ukrainische Familien Zuflucht gefunden haben. Ursprünglich war geplant, dass die Ausstellung auch in der Ukraine gastiert. Das geht durch den Krieg nicht. Umso mehr freue ich mich jetzt aber auf ein anderes gemeinsames Projekt. Wir werden am 13. März mit jeweils acht Jugendlichen aus Deutschland, Polen und der Ukraine zu einem im Rahmen der DPJW (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) Kooperation geförderten #StolenMemory-Seminar in Oświęcim (Auschwitz) zusammenkommen. Ich begleite die acht Schülerinnen und Schüler von einer Schule in Kyiv.

#StolenMemory-Ausstellung zu Gast in Zamość in Polen

60 Effekten von Menschen aus der heutigen Ukraine lagern bei den Arolsen Archives ein. Bei #StolenMemory suchen wir zum Beispiel Angehörige von Maria Holowko, geboren am 29. Oktober 1926 in Posiolok im Oblast Dnipropetrowsk.
Für wie wichtig halten Sie Projekte wie diese?
Austauschprojekte sind sehr wichtig. Sie geben viel Hoffnung für die Zukunft. Je mehr wir solche Projekte machen, desto mehr Chancen haben wir auf eine friedliche Zukunft. Persönliche Gespräche helfen auch eigene Stereotypen abzubauen und wirklich voneinander zu lernen. Jugendliche aus Deutschland oder Polen erfahren aus erster Hand, wie schrecklich der Krieg ist, wie wichtig die Menschen um dich herum sind, wie wichtig soziale Kontakte sind. Ein Menschenleben hat den höchsten Wert, darum geht es im Projekt. Die Arolsen Archives spielen hier eine wichtige Rolle: Wenn wir nicht über unsere Vergangenheit reden und nichts darüber wissen, dann wird es immer Kriege geben. Die Geschichte wird dann durch irgendwelche Mythen ersetzt. Das ist genau das, was gerade wieder passiert. Umso wichtiger ist es, dass die Arolsen Archives Originaldokumente verwahren und dass sie sie zugänglich für alle machen. Es ist wirklich toll, dass Vieles mittlerweile online ist und weltweit Menschen hilft, Familiengeschichte zu rekonstruieren. Aus der Geschichte, Optionen für unsere Zukunft zu entwickeln, zusammen mit Schülerinnen und Schülern, auf dieses Projekt freue ich mich. Wenn die junge Generation schafft zu lernen, wie wir friedlich miteinander umgehen können, dann haben wir eine Hoffnung auf eine friedliche Zukunft.
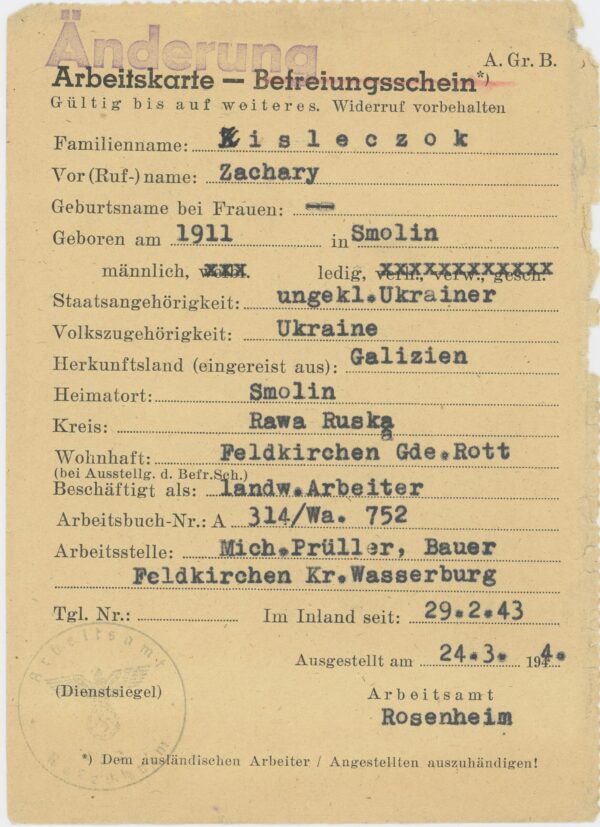

Unser Ukraine-Hilfsnetzwerk
Die Arolsen Archives sind Mitglied im Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine. Das Hilfsnetzwerk unterstützt seit dem Angriffskrieg nicht nur Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine, sondern auch ihre Familien sowie durch den Krieg betroffene Kolleg*innen unbürokratisch und effektiv. Rund 46 Initiativen, Stiftungen, Erinnerungsorte und Gedenkstätten aus Deutschland machen mit. Gemeinsam rufen wir zu Spenden auf, um den Holocaust-Überlebenden und ihren Angehörigen zu helfen. https://hilfsnetzwerk-nsverfolgte.de/

